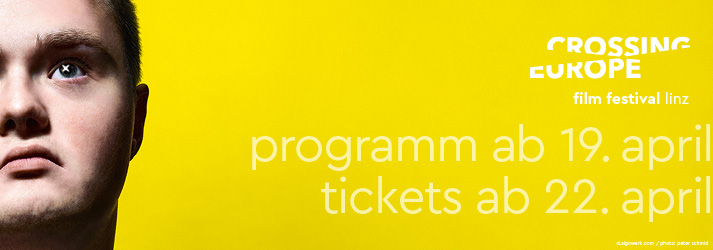Fr, 26. April
121min, OmdtU
121min, Engl./OmdtU
105min, OdF
120min, -
Movie 2
Special Screening: „anton bruckner 2024“: DIE PHANTASTISCHE
Special Screening
Anmeldung mit Angabe der Sitzplatz-Anzahl bitte an: Be.Buero@kunstuni-linz.at